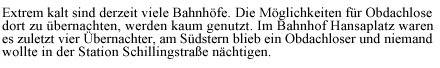Mehr Wirtschaft! - Einladung zur Kaffeepause
Ein Film aus der Reihe: Mein surrealer Alltag.

"Gute Rechtschreibung hat mir nie großen Respekt abgenötigt. (...) Bevor die Rechtschreiblehre mit ihren eigenmächtigen Regeln herauskam, haben die Leute mit ihrer Orthographie feine Züge ihres Charakters unbewusst enthüllt und dem, was sie schrieben, aufschlussreiche Ausdrucksnuancen zugefügt. Es ist durchaus möglich, dass die Rechtschreiblehre für uns ein Geschenk von zweifelhaftem Wert war." (Mark Twain)
Und Goethe war Rechtschreibung allemal egal:"Mir, der ich selten selbst geschrieben, was ich zum Druck beförderte, und, weil ich diktierte, mich dazu verschiedener Hände bedienen musste, war die konsequente Rechtschreibung immer ziemlich gleichgültig. Wie dieses oder jenes Wort geschrieben wird, darauf kommt es doch eigentlich nicht an: sondern darauf, dass die Leser verstehen, was man damit sagen wollte! Und das haben die lieben Deutschen bei mir doch manchmal getan.“ (Johann Wolfgang Goethe)
Das sollte Fußpflegern und Bloggern recht sein.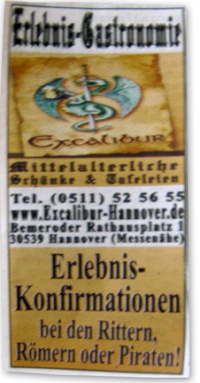 ... wirft aber auch Fragen auf. Sollte ein junger Mensch besser von Rittern, Römern oder Piraten konfirmiert werden? Soll man ihn den wilden Tieren vorwerfen, ihn einen Kopf kürzer machen oder besser über die Planke schicken?
... wirft aber auch Fragen auf. Sollte ein junger Mensch besser von Rittern, Römern oder Piraten konfirmiert werden? Soll man ihn den wilden Tieren vorwerfen, ihn einen Kopf kürzer machen oder besser über die Planke schicken?
Der Jäger macht beinah einen Namenwitz. Im Printmedium sind Namenwitze grundsätzlich verpönt. Das Hänseln mit dem Namen gehört in den Kindergarten, und spätestens nach der Pubertät, sollte man es lassen. Ein wenig anders verhält es sich, wenn jemand den Namenwitz provoziert wie etwa die Journalistin Doris Köpf. Nach der Heirat mit Gerhard Schröder stellte sie ihren alten Namen selbstbewusst voran und nannte sich Doris Köpf-Schröder, wie sich hier und hier noch lesen lässt.Ein Jäger kauft bei einem Züchter namens Schindler einen hoch gelobten Schweißhund. Der Hund aber entpuppt sich als Niete beim Aufspüren der Fährten. Da schreibt der Jäger an den Züchter: „Sehr geehrter Herr Schindler, das W, das in Ihrem Namen fehlt, hat Ihr Schweißhund zuviel.“
„Sprachunrichtigkeiten sind Zeichen des Lebens; die Sprachrichtigkeit aber ist das Zeichen der Krankheit, der Vorbote des Todes. Niemand kann sagen, was tadelloses richtiges Deutsch ist, wohl aber gibt es zweifellos richtiges ciceronianisches Latein.“In diesem Sinne betreiben Sprachpfleger aktive Sterbehilfe. Sie haben die in der Schule gepaukten Regeln verinnerlicht, und stolz auf diesen schmalen Besitz sind sie von dem Drang beseelt, ihren Mitmenschen vorzuschreiben, wie sie zu sprechen oder zu schreiben hätten. Hauen ihnen den Duden oder Sicks Oberlehrerbuch um die Ohren. Wären alle Mitglieder einer Sprachgemeinschaft so obrigkeitshörig, wären alle derart von einem Sprachreinigungsdrang besessen, wie sollte sich die Sprache überhaupt verändern können?

 Wie kommt wohl die argentinischen Präsidentin Christina Fernandez auf die Idee, Schweinefleisch sei besser als Viagra?“ Schon eine gekringelte Brätwurst lässt doch ganz andere Wirkungen vermuten. Vielleicht lieber nur äußerlich anwenden, etwa als erotisierende Halskette? Christina Fernandez hat das gewiss nicht ernst gemeint. Sie hat sich das wirre Zeug nämlich vor Vertretern aus der Fleischindustrie oben rausgedrückt.
Wie kommt wohl die argentinischen Präsidentin Christina Fernandez auf die Idee, Schweinefleisch sei besser als Viagra?“ Schon eine gekringelte Brätwurst lässt doch ganz andere Wirkungen vermuten. Vielleicht lieber nur äußerlich anwenden, etwa als erotisierende Halskette? Christina Fernandez hat das gewiss nicht ernst gemeint. Sie hat sich das wirre Zeug nämlich vor Vertretern aus der Fleischindustrie oben rausgedrückt.